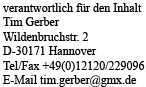Totenstille vor der Botschaft
Der gescheiterte Versuch, eine Flüchtlingsfamilie aus dem Kosovo nach Deutschland zu holen
von Tim Gerber
| [Home] [Übersichtskarte] [Sachalin] [Städte] [Tiere] [Petroglyphen] |
|
 Durrës im April 1999 Was die jungen Männer vorhaben, die in aller Herrgottsfrühe in kleinen Grüppchen vor dem verschlossenen Hafentor des italienischen Adriastädtchens Bari herumstehen, kann man nur ahnen. Ihre Gesichter sind apathisch leer, ihre Blicke, als hätten sie mit dem Diesseits bereits abgeschlossen. Jedenfalls sprechen sie Albanisch, wie Naser Aremi* schnell herausfindet: der Hafen öffne um 7.00 Uhr, wissen sie.
Durrës im April 1999 Was die jungen Männer vorhaben, die in aller Herrgottsfrühe in kleinen Grüppchen vor dem verschlossenen Hafentor des italienischen Adriastädtchens Bari herumstehen, kann man nur ahnen. Ihre Gesichter sind apathisch leer, ihre Blicke, als hätten sie mit dem Diesseits bereits abgeschlossen. Jedenfalls sprechen sie Albanisch, wie Naser Aremi* schnell herausfindet: der Hafen öffne um 7.00 Uhr, wissen sie.
Schnell wendet er sich von dem unheimlich anmutenden Trupp wieder ab, denn um sein Leben aufs Spiel zu setzen, ist der gebürtige Kosovare(37), der seit über einem Jahrzehnt als Bauingenieur in Berlin lebt, hier nicht angetreten. In einem mit Schlafsäcken, Lebensmitteln und Medikamenten bis unters Dach überladenen, geliehenen Kleinbus ist er zusammen mit seiner deutschen Frau Christiane(30) in achtzehnstündiger Non-Stop-Fahrt hergekommen, um seine Eltern, seine Geschwister und die sonst noch am Leben befindlichen engsten Angehörigen in einem Flüchtlingscamp nahe der albanischen Hafenstadt Durrës aufzusuchen. Ihre beiden kleinen Kinder, den fünfjährigen Leo und die knapp zweijährige Marie, hat das deutsch-albanische Ehepaar derweil in der Obhut der deutschen Großmutter zurücklassen müssen.
Über eine Woche lang hatte Naser nichts von seiner Familie im Kosovo gehört, dann riefen sie aus Albanien an: ja, man sei noch am Leben - zum großen Teil jedenfalls, mehr aber auch nicht. Seine beiden Schwager allerdings - die unzähligen Berichte junger Witwen in diesen Tagen, wie man vor ihren Augen die Männer erschossen habe, hier haben sie Namen und Gesichter, sind es Schwester und Cousine.
Das Hafentor wird geöffnet, doch eine Autofähre gibt es erst am späten Abend. So beschließen wir, die nächste Personenfähre in drei Stunden zu nehmen, packen etwa 150 kg Gepäck zusammen und schleppen es durch die Hafenkontrollen zum Schiff. Vier Stunden lang schüttelt uns das norwegische Schnellboot mit seiner albanischen Besatzung über die diesige Adria. Ein Hubschrauber der italienischen Küstenwache umkreist uns ein paar Mal und verschwindet dann. Schließlich herrscht Krieg auf diesem Meer, und keine Maus bewegt sich unkontrolliert auf ihm. Die Einreiseformalitäten vollziehen sich in geordnetem Chaos. Selbstverständlich knöpft man uns Deutschen jeweils 70 DM für ein Visum ab, das es offiziell gar nicht gibt. Und weil man mit Westeuropäern nichts anderes anzufangen weiß, steht in unserem Einreisepapier "Gazetar" - Journalist.
Das klapprige Taxi holpert tatsächlich mit uns zu einem Flüchtlingscamp. Wir laden das Gepäck ab, doch ob es das richtige Camp ist, wissen wir noch nicht.
Sofort werden wir von Fremden umringt, die Masse unseres Gepäcks erregt Aufsehen. Wir sehen nicht aus, als seien wir auf der Flucht, wie all die anderen hier. Naser begibt sich auf die Suche nach seiner Familie. Bange Minuten vergehen, dann kehrt er zurück. Schweigend kommen sie auf uns zu gelaufen, der Vater aus dem Kosovo, gebeugten Hauptes geht er neben seinem Ältesten aus Deutschland her. Stille Tränen in den Augen - beide. Umarmungen und Blickkontakte, in denen man sich die Fassungslosigkeit ohne Worte zu bestätigen sucht - dies ist kein normales Wiedersehen, kein Familientreffen der üblichen Art. Unbeschreiblich ist es, was in den nächsten Minuten vor sich geht. Zum ersten Mal nimmt Nassers Mutter ihre deutsche Schwiegertochter in den Arm, die beiden hatten sich bisher nicht gekannt - wie viele bessere Umstände für eine solche Begegnung lassen sich denken, als diese, verzweifelten, aussichtslosen. Schließlich stoßen hier nicht nur Generationen aufeinander, sondern auch verschiedene Kulturen, in denen Frauen eine gänzlich andere Position in der Familie inne haben. Neun Kinder hat die Schwiegermutter - geduldig unter dem Patriarchat ihres Mannes lebend - geboren, sieben davon groß ziehen können. Ihr ganzes Leben, ein und alles. Christiane hingegen besucht neben der Kindererziehung die Humbold-Universität, um Geschichte und Ethnologie zu studieren. Doch hier, inmitten dieses Leids, das über die Familie gekommen ist, sind die beiden so verschiedenen Mütter sich auf der Stelle näher, als sich eine Schwiegermutter und -tochter je kommen könnten.
Am schnellsten fängt sich der sehnige alte Vater mit dem buschigen grauen Schnauzbart wieder. Von seinem einst beträchtlichen Bierbauch ist nichts geblieben seit der Flucht. Die tiefen, listigen Augen, zwischen denen eine gewaltige Hackennase hervorspringt, beginnen kurz zu funkeln, und er entnimmt dem Kofferraum des geretteten Mercedes-Diesel eine Flasche Selbstgebrannten. Er reicht sie mir - ein kräftiger Hieb daraus tut Not - und erzählt mir mit Gesten davon, daß die Serben ihm über 600 Liter von diesem edlen Gebräu zu Hause zerstört hätten. Die Schwiegersöhne, die er verloren hat - davon will er wohl nicht sprechen.
Wie nun weiter? Man bringt Decken aus dem Camp von der anderen Straßenseite auf die Wiese, wir sollen es uns gemütlich machen, uns niederlassen. Die von uns mitgebrachten Lebensmittel werden ausgepackt, Wurst und Brot. Niemand ißt etwas. Wir werden dazu genötigt - schließlich seien wir die Gäste von weither, die sich stärken müßten. Man bedauert, uns nun nichts Besseres bieten zu können. Die Kinder schauen zu mit ihren aufgerissenen Augen. Sie haben Hunger. Noch immer wagt niemand zu essen. Schließlich nehmen wir doch einen Happen, in der Hoffnung, man werde es wenigstens dann uns gleich tun. Zwecklos. Ich kriege nichts runter, nur den Schnaps, den das Familienoberhaupt kreisen läßt. Er wärmt.
So beschließen wir, sie zunächst einmal allein zu lassen, um Kontakt mit der italienischen Lagerverwaltung aufzunehmen, wiederum in der Hoffnung, unsere ausgemergelten Gastgeber würden wenigstens dann etwas vom Mitgebrachten zu sich nehmen. Weit gefehlt. Nach Tagen taucht die eingeschweißte Wurst unberührt im Zelt der Familie wieder auf, man habe sie schließlich für uns aufbewahrt. Naser läuft rot an und schreit auf seine Mutter ein, die die eindringliche Belehrung des geliebten Sohnes mit ihrem üblich warmen Lächeln aus dem rundlichen Gesicht unter dem obligatorischen Kopftuch über sich ergehen läßt. Auch in dieser elenden Situation will die schwer rheumakranke alte Frau nicht davon abkommen, einzig und allein für ihre Kinder zu sorgen zu haben. Wer weiß schließlich, ob es denen zu Hause in Deutschland wirklich so gut geht, wie sie es hier beteuern.
Der Kontakt mit den italienischen Carabinieri, die das Camp bewachen, kommt nur schwer in Gang. Kaum einer spricht Englisch, es ist schwer, uns verständlich zu machen. Und schließlich lungert allerhand zweifelhaftes Volk um das Camp herum, da heißt es, ein strenges Regime zu führen. Den Einheimischen rings ums Lager geht es, abgesehen davon, daß sie ein irgendwie geartetes Dach über dem Kopf haben, nicht wesentlich besser, als den Flüchtlingen drinnen, die wenigstens mit dem Nötigsten regelmäßig versorgt sind, und zum Teil, so sie es haben retten können, sogar über etwas Geld verfügen.
Gerüchte machen die Runde, Albaner hätten einem Kosovaren das Auto gestohlen und die darin schlafenden Kinder ermordet. Wenig vertrauenserweckende Typen tauchen auf, sie würden junge Mädchen zu sich aufnehmen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, albanische Mafiosi würden Mädchen aus den Camps und den Flüchtlingstrecks verschleppen, um so für Nachschub auf westeuropäischen Strichs zu sorgen. Schlepper haben Hochkonjunktur, 3000 Dollar pro Kopf für eine Überfahrt. Es gibt keinen Wald ohne Schweine, heißt ein albanisches Sprichwort. Naser und Christiane sind wild entschlossen, ihre Familie auf legalem Wege mit nach Deutschland zu nehmen, sie in Sicherheit zu bringen und für sie zu sorgen, bis sie - und das steht für alle außer Zweifel - in den Kosovo zurückkehren können. Daß sie sich dafür selbst an den Rande des Ruins bringen könnten, was bedeutet das schon. Auch in Deutschland gibt es schließlich so etwas wie Solidarität unter Freunden. Und vielleicht geht der Spuk ja schneller vorbei, als man es im Moment zu glauben wagt.
Telefonieren! Wo? Gegenüber in einem Häuschen mit Terrasse wohnt eine freundliche albanische Familie mit Telefon. Das Ritual ist bereits eingespielt. Abends ab 6 wird das Telefon auf die Terrasse gebracht, Stühle aufgestellt und es darf telefoniert werden - in geordneter Reihenfolge versteht sich. Man schaut auf die Uhr und erhebt seine Gebühren - Rückrufe sind möglich. Fasse Dich Kurz! Es herrscht reger Andrang und um 22.00 Uhr ist Feierabend, dann will man seine Ruhe haben.
Das Außenamt nennt mir die Nummer der Botschaft in Tirana, diese sei rund um die Uhr besetzt, heißt es. Eine freundliche Anrufbeantworterdame diktiert eine Nummer "außerhalb unserer Öffnungszeiten in dringenden Notfällen", als kämen dafür nur unvorsichtige Adriaurlauber, die sich bestehlen lassen haben, in Betracht. Alles um uns herum ist ein einziger dringender Notfall. Unter der Notnummer teilt uns der Sicherheitsbeamte gelassen mit, wir mögen am Montag Morgen um acht kommen, vorher sei niemand zu sprechen. Heute ist Samstag.
Inzwischen ist es Abend geworden, unsere Schlafplätze werden organisiert. Autos haben sie noch, die Nachbarngemeinschaft hat sie auf den Parkplätzen vor dem Camp zu einer Art Wagenburg zusammen gestellt und man bewacht sie gegenseitig. Autos ohne Nummernschilder - die Serben haben sie abgeschraubt; Autos, denen sie ihr Leben verdanken.
Inzwischen ist es uns gelungen, einen englischsprechenden Mitarbeiter der italienischen Hilfsorganisation, die das Lager versorgt, ausfindig zu machen. Die Familie mitzunehmen, kann er uns nicht helfen, bedauert er, denn auch aus seiner Sicht wäre dies wünschenswert. Es würde ein Zelt frei, blieben dringend benötigte Schlafsäcke zurück. Er zeigt Mitgefühl. Jedenfalls läßt man uns nun mit ins Camp, den Carabinieri hinterlegen wir unsere Pässe.
Wir werden ins Zelt geladen, wo die Kinder schon schlafen. Man läßt sich nieder, redet mit Worten und Gebärden. Und - fast ist es wie daheim im Städtchen Gjakovës - es klopfen die Nachbarn an, mit denen man gemeinsam geflohen ist. Sie werden hereingebeten, die Männer hocken unter sich, die Frauen in der anderen Ecke des Zeltes. Wieder kreist die Flasche mit dem wohltuenden Klaren. Ach, zu Hause habe man dazu stets auch gut gegessen, erzählt mir ein Nachbar, der ein wenig Englisch spricht. Nun seien ihnen zur gemütlichen Runde nur ein paar Schnapsflaschen geblieben. Man lebt. Es ginge schon, wenn nur die Nächte nicht so kalt und der Geröllboden unterm Zelt nicht so steinig wäre.
Und noch etwas haben sich diese Menschen auf ihrer dreitägigen unsäglichen Flucht ins Ungewisse bewahren können: ihre Menschenwürde! Unantastbar sei sie, sagt das Deutsche Grundgesetz - Angriffe auf ihre Menschenwürde haben sie von serbischer Seite genug erfahren müssen, doch sie ist ihnen geblieben.
Der genossene Alkohol hilft beim Einschlafen, und das gleichmäßige Brummen uns überdröhnender Flugzeuge gibt wenigstens das wage Gefühl, daß immerhin irgend etwas getan wird, dies Elend zu beenden. Ob es das Richtige ist - die Flüchtlinge hier hegen daran keine Zweifel. Am nächsten Morgen beschließen wir, auf telefonische Auskünfte nicht vertrauend noch an diesem Sonntag die Deutsche Botschaft aufzusuchen. Tirana ist nur 38 km entfernt und Vater hat ja noch seinen geliebten 200D-8. Fast zärtlich rückt er den Stern gerade, klemmt sich hinter das Lenkrad seines geliebten Gefährts Stuttgarter Bauart, in welchem er mit seiner zehnköpfigen Familie drei Tage und drei Nächte in Angst und Schrecken verbracht hat, das ihnen schützender Lebensretter war. Keine Frage, daß nur er selbst es fahren darf. Ein Werbespruch der schwäbischen Autobauer kommt mir in den Sinn. Bei der Andeutung seines Sohnes, er müsse das Auto womöglich hier zurücklassen, bricht der alte Man in Tränen aus.
Die Polizeikontrollen können wir nach inzwischen eingeübtem Muster passieren: wir beiden Deutschen springen mit gezückten Pässen und wichtiger Mine aus dem Fahrzeug auf die albanischen Polizisten zu und werfen ihnen in Staccato-Englisch irgendwelche Brocken hin, in denen die Stichworte "Germany" und "Ambassadore" vorkommen müssen. Aber an der letzten Kontrolle hilft auch das nichts mehr. Der Vater muß mit dem Auto zurückbleiben (niemals würde er es hier allein lassen), und uns nimmt ein bereits vollbesetztes deutsches Auto, das zufällig vorbei kommt, mit nach Tirana. Am Armaturenbrett baumelt ein Schlüsselanhänger: U(K. Totenstille vor der Botschaft. Wir winken mit unseren Pässen und läuten Sturm. Der Sicherheitsbeamte ist zunächst ungehalten, gibt uns dann aber immerhin Visaanträge mit. Am nächsten Tag werden wir noch erleben dürfen, daß dies so selbstverständlich nicht ist, die Albaner betreiben bereits schwunghaften Handel mit Xeroxkopien dieser nutzlosen Hoffnungspapiere. Von jedem Familienmitglied müssen also zwei Paßfotos her - ein Problem, mit dessen Lösung wir in diesem Land ohne jegliche erkennbare Infrastruktur die verbleibenden 16 Stunden bis zur "Öffnung" der Botschaft am nächsten Morgen zu verbringen haben. Wenigstens nicht einfach nur die Zeit verwarten müssen. Fast möchte man über jede harte Nuß, die uns die Botschaft noch zu knacken geben wird, im Nachhinein dankbar sein, hätten sie sich nicht hinterher als gänzlich verlorene Liebesmühen erwiesen. In Bonn hatte man mir vorab ja beschieden, es werde in Fällen wie diesem schnell und unbürokratisch geholfen.
Auf dem Rückweg zum Camp begegnen wir etlichen Lastern vom THW. Wie wir erfahren, wird von den Deutschen zusammen mit den Schweizern ganz in unserer Nähe eine riesige Zeltstadt für 20.000 Flüchtlinge errichtet. Wir fahren hinterher, um ausfindig zu machen, ob Naser seine Familie - falls die Mitnahme entgegen unserer festen Hoffnung doch scheitern sollte - dort unter Obhut einer deutschen Organisation nicht besser wird unterbringen können und dadurch leichter in Kontakt zu bleiben wäre. Vor Ort herrscht Perfektion in Sachen humanitäre Hilfe. "Wir machen nur Logistik", kriegen wir zu hören. Das THW sorgt für die Infrastruktur, Strom und Wasser, die Schweizer liefern die Zelte. Verwaltet wird das Lager von den albanischen Behörden selbst. Wann die ersten Flüchtlinge kämen, wisse man nicht, ca. 100 hätten schon allein hergefunden. Viele Zelte warten darauf, belegt zu werden.
In Durrës kriegen wir die selbstgefertigten "Paßfotos" nicht mehr entwickelt. Zurück an unserem Camp ist inzwischen eine Kolonne von Sammeltaxis, vollgestopft mit bis zu 30 Flüchtlingen pro Wagen, angekommen. Sie legen ihr letztes Geld zusammen, um sich von albanischen Taxifahrern in ein sicheres Camp bringen zu lassen. Am Morgen hatte es Gerüchte gegeben, die UÇK habe einige Dörfer befreit und einen Flüchtlingskorridor geschlagen.
Die Fahrer sind genervt. Die Italiener können niemanden mehr aufnehmen, von dem benachbarten Camp wissen sie offenbar nichts. Die, um die es eigentlich geht, sind hilflos verstummt, quetschen sich verängstigt in den Kleinbussen. Kurz entschlossen setze ich mich in den ersten neben den Fahrer. Nie werde ich diese Gesichter vergessen, nie die verängstigten großen Kinderaugen, die fahlen Frauen, den alten Mann mit der blutigen Nase. Ich wende mich zu ihnen, versuche, ihnen mit einem klaren, offenen Blick zu begegnen, als ich ihnen mit wenigen Worten und Gesten zu bedeuten versuche, ich käme aus Deutschland und würde sie jetzt zu einem Lager begleiten, wo leere Zelte für sie bereitständen.
Die ausländischen Mitarbeiter der Hilfswerke haben längst Feierabend und sind in ihre Hotels gefahren. Vor Ort nur noch albanische Sicherheitskräfte, die aber niemanden in die leeren Zelte lassen wollen. Die Flüchtlinge müßten erst in die Präfektur nach Durrës um sich dort registrieren zu lassen. Das könne man morgen - nein! Schnell bin ich mir mit dem jungen albanischen Dolmetscher einig, daß wir es uns nicht mit ansehen werden, wie diese Geschundenen eine weitere Nacht in Kälte und Schlamm neben fertigen Zelten verbringen werden - von Bürokratismus wegen. Mit Blaulicht und Sirene geht's in die Präfektur, nur daß unser Haupthindernis, die unzähligen Schlaglöcher, auch diesem nicht weichen. Es bleibt beim Schrittempo.
Unser cleverer Dolmetscher bringt uns zum Präfekten selbst, immer schön mit dem Hinweis auf mich, der ja immerhin eigens aus Deutschland käme und nun verlange, daß die Flüchtlinge ins Lager gelassen werden. Ernste Gesichter. Im Hintergrund läuft ein kleiner Fernseher: der Formel-1 Grand Prix. Der Präfekt wirft einen noch ernsteren Blick auf mich, dann nickt er: ja, die Flüchtlinge müssen in die Zelte, die Registrierung könne man morgen erledigen. Wie er uns autorisieren werde? Sein Polizeipräsident begleitet uns. Die irrwitzige Frage zum Abschied, wo denn der Schumacher steht, kann ich mir zum Abschied nicht verkneifen.
In wilden Sprüngen über die Schlaglöcher geht's zurück ins Camp, der Polizeipräsident muß noch ein wenig durchs gereichte Walky-Talky schimpfen, dann dürfen die ersten in ihre Zelte. Zurück bei den Meinen kriege ich erst mal wieder einen großen Schluck aus Vaters Flasche gereicht. Man klopft mir auf die Schulter: morgen nehmen wir die nächste Bastion der Bürokratie - die deutsche Botschaft.
Heute will es mit den Polizeikontrollen nicht so gut klappen, Vater muß seinen Daimler schon ca. 10 km vor Tirana abstellen. An einer Tankstelle entrichtet er eine "Bewachungsgebühr", das ist ihm die Sicherheit seines Autos wert, denn heute muß er mitkommen. Kein Taxi weit und breit, da quietschen Bremsen hinter uns: Santini et Co.! Unsere italienischen Freunde aus dem Camp - inzwischen hat man sich ja besser kennengelernt - die schickt der Himmel. Klar nehmen sie uns in ihrem Kleintransporter mit nach Tirana. Santini schraubt erst noch die Fahne aufs Dach, denn er hat es satt, alle drei Kilometer aufgehalten zu werden, obwohl das Auto deutlichst als das einer Hilfsorganisation erkenntlich ist.
Sie bringen die beiden elternlosen Kinder (ca. 10 und 12 Jahre alt), die gestern vor dem Camp angekommen sind, nach Tirana. Unterwegs entwickelt sich eine neue Art Esperanto; nur gut, daß Santinis Vorfahren ihre Sprache bis auf die britanische Insel trugen. Mit ein bißchen Phantasie läßt sich Englisch ins Romanische zurücktransformieren. Wir krakeln unsere Adressen, gern wollen wir uns irgendwann wieder mit ihnen treffen, sei's in einem Berliner Biergarten, sei's bei einem Gläschen Gianti. Wir fühlen uns als Landsleute, EU-Bürger eben.
Vor der Botschaft herrscht Gedränge, weit weniger jedoch, als wir vermutet hätten. Da dürfte im friedlichen Warschau weit mehr los sein. Klar, kaum einer dringt bis hierher durch, die meisten, die eben nicht über deutsche Pässe verfügen, werden schon weit vorher zurückgehalten. Die hier stehen, sind mehrheitlich Männer aus dem Kosovo, die vor dem Wehrdienst in der jugoslawischen Armee Asyl in irgend einem westeuropäischen Land gesucht haben. Mit ihren jugoslawischen Pässen und der deutschen Aufenthaltsgenehmigung sind diese Kosovaren nicht viel mehr als Staatenlose. Nun suchen sie ihre Familien und niemand hilft ihnen dabei.
Christiane und ich sind also die einzigen "echten" Deutschen hier, dennoch denkt man überhaupt nicht daran, uns das Tor zu öffnen. Wir mögen Verständnis für die angespannte Sicherheitslage haben. Ob ich etwa ein Sicherheitsrisiko sei? Keine Antwort. Ich muß mich zusammenreißen, versuche höflich zu bleiben. Ich verlange einen Botschaftssekretär zu sprechen. Ja, selbstverständlich könne ich einen Termin bekommen, "Wen darf ich bitte melden und in welcher Angelegenheit? Oder melden Sie sich doch bitte telefonisch oder per Fax an." Ob er ahnt, wieviel Kraft und Nerven wir noch haben für solche Spielchen? Aber genau das ist ja das Spiel, wir sollen zermürbt aufgeben. Es ist wie bei Kafka: "Das Fürstenzimmer geb' ich Ihnen gern" - aber in die Botschaft kommen Sie nie und nimmer.
Der Beamte von gestern sucht eine günstige Gelegenheit, um uns zu sagen, wenn wir bis eins mit den Fotos kämen, könne er eventuell etwas für uns tun. Aber es gäbe eben nur einen Sachbearbeiter für Visaangelegenheiten, der hoffnungslos überlastet sei. Nein, das Personal sei nicht verstärkt worden.
Der Krieg ist schon drei Wochen alt, über Ostern war die Botschaft geschlossen. Hier scheint man das Grundgesetz mit der Arbeitszeitordnung verwechselt zu haben. Die Fotos sind in drei Stunden fertig, sie sind sogar etwas geworden. Besonders die Kinder sehen so süß darauf aus. Aber ans Familienalbum kann jetzt nicht gedacht werden, es ist bereits zwölf. Vor dem Botschaftstor sind es weniger geworden, die Einlaß begehren. Dafür ist Bundesgrenzschutz aufgetaucht. Die Sicherheitslage. Ob die hier auch verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen? Wer weiß. Jemand sei mit gefälschten Pässen dort aufgetaucht, heißt es. Sicher muß man unkontrollierten Zustrom verhindern, sicher Trittbrettfahrern und Schleusern das Handwerk vermiesen, aber die Behörde hat Einzelfälle zu prüfen und nicht generell alle abzuweisen. Und Christianes Fall ist prüfbar, seit über einem Jahrzehnt zahlen sie und ihr Mann Naser in Deutschland Steuern. Wofür, wenn das Gemeinwesen, an dem sie teilhaben, in der Not nicht hilft?
Offiziell hat die Konsularabteilung zwar seit acht geöffnet, rein oder raus gekommen ist dennoch niemand. Man ist schließlich überlastet, nur womit eigentlich, wenn man sowieso keine Visaanträge annimmt, nicht einmal die Formulare austeilt?
Nach weiterem Hin und Her mit dem einzigen zugänglichen Sicherheitsbeamten wird Christiane tatsächlich von einem unfreundlichen Dolmetscher in die Botschaft gelassen. In den Händen hält sie fest umklammert 7 Visaanaträge in zweifacher Ausfertigung, säuberlichst ausgefüllt und alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen; dazu die Fotos und die verbliebenen Pässe der Familie, soweit sie noch welche haben.
Ich werde euphorisch, kann mir einfach nicht vorstellen, daß man Christiane unverrichteter Dinge wieder vor die Tür setzen wird. Man wird. Nach ganzen 10 Minuten steht sie wieder auf der Straße, mit den Anträgen in der Hand, wie sie hineingegangen war. Sie geht in die Knie, hockt sich auf den Rinnstein und bricht in Tränen aus. Es dauert einige Minuten, bis sie in der Lage ist zu berichten, was sich drinnen abgespielt hat. Immer noch schluchzend schildert sie die Kaltschnäuzigkeit, mit der ihr der Sachbearbeiter verkündet hat, die Pässe seien ja zum großen Teil abgelaufen, da ginge gar nichts. Für die beiden einzigen Familienangehörigen, die noch über gültige Pässe verfügen, die beiden überlebenden Männer, Nassers Vater und Nassers taubstummer Bruder (das Handikap hat ihm das Leben gerettet), müßte sie bei der Berliner Ausländerbehörde Einladungen besorgen unter Vorlage einer Verdienstbescheinigung. Mit dieser könnten die beiden dann kommen und ein Besuchsvisum beantragen. Als ob an ihrem Flüchtlingszelt ein Briefkasten hinge, der Briefträger vorbeikäme. Und niemand wird die beiden allein jemals in die Botschaft vorlassen. Aber klar, die wollen ja Urlaub an der Nordsee machen, und die Frauen können mit den Kindern derweil ruhig "daheim" im Flüchtlingscamp auf die Postkarten der Männer warten.
Vor mir steht Shquippe, Nassers Schwester, ihre anderthalbjährige Tochter mit den fiebrig geröteten Augen auf dem Arm. Die Kleine und das Kind, das sie noch erwartet - Halbweisen beide. Eine Nacht hat sie mit dem Kind in einem Gebüsch hinter ihrem Haus verbracht und zugesehen, wie die Serben es zerstörten, die Leiche ihres Mannes darinnen. Erst am Morgen konnte der Vater mit dem Auto sie auflesen.
Die Leichen der Erschossenen werden mit Flammenwerfern verkohlt und dann mit Videokameras gefilmt. Den Vater habe man, wie viele andere, mit vorgehaltener Kalaschnikow gezwungen, vor der Kamera auszusagen, die Toten rührten vom Bombardement der NATO her. Der alte Mann will nichts gesehen haben.
Die Frauen umzubringen, ist überflüssig. Ihr Leben löscht man auch so aus, ohne Munition. Sie sind erzogen, daß Mann und Kinder, die Sorge um Familie und Haushalt, ihr einziger Lebensinhalt sind. Einen Mann aber werden die unzähligen Witwen nicht mehr finden und sich bis an ihr Lebensende als nutzlose Esser in den Familien ihrer Väter fühlen.
Wenn wir sie doch nur für eine Zeit mit nach Deutschland nehmen könnten, die schöne Shquippe mit den klugen dunklen Augen, ihren Schock therapieren und sie in Frieden ihr Kind gebären lassen. Derweil hätte sie Deutsch gelernt und könnte beim Wiederaufbau des Kosovo eine neue Aufgabe finden. Immerhin hat sie - im Gegensatz zu den meisten ihrer Schicksalsgenossinen - einen Beruf gelernt: sie ist Handelskauffrau.
Christiane sitz noch immer auf dem Mauersims der Botschaft. Wenn man bedenkt, welch immenser Aufwand für die Betreuung der Angehörigen bei Flugzeugkatastrophen oder zuletzt in Eschede betrieben wird. Das soll keinesfalls in Frage stehen. Aber daß in dieser Massenkatastrophe auch Deutsche betroffen sind, die solcher Hilfe bedürften, daran scheinen Kohls Beamte in Fischers Außenhaus keinen Gedanken verschwenden zu wollen.
Schily und Fischer seien dort gewesen und hätten nach einem Besuch in den Flüchtlingscamps die Anweisung bekräftigt, in Visaangelegenheiten zu verfahren wie bisher, hatte der Sachbearbeiter gesagt. Mag sein, doch nicht die Anweisungen von irgendwelchen Dienstherren sind maßgeblich für staatliches Handeln, sondern Recht und Gesetz allein, die Grundrechte hier ganz besonders, die den Staat als direkt geltendes Recht binden.
Karlsruhe ist weit weg, aber der Hohe UN-Kommissar für Flüchtlingsangelegenheiten (UNHCR) hat einen Sitz in Tirana. Für Flüchtlinge ist er zwar nicht zu sprechen, aber Christiane darf auf einen Vertreter warten, stundenlang.
Naser und ich können inzwischen in einem versteckten Hinterhaus ohne jede Beschilderung ein Büro ausfindig machen, wo eine albanische Behörde Flüchtlingsausweise ausstellt. Die freundlichen Beamten dort fallen uns fast um den Hals, weil wir so gut ausgestattet sind mit den Fotos und den Visaanträgen, so daß sich die Registrierung als ein Kinderspiel erweist. In einer guten halben Stunde ist alles kopiert und wir können zehn kleine Plastikkärtchen mitnehmen, Foto, Name und Geburtsdatum darauf. Die Kinder sehen immer noch süß aus auf ihren Kärtchen. Gerade noch können wir sie Christiane bringen, die eben beim Flüchtlingskommissar vorgelassen wird. Der Mitarbeiter erklärt ihr, daß man mit dem Ausstellen von Flüchtlingspässen der UNO frühestens in zwei bis drei Wochen beginnen könne. Aber da sie die albanischen Ausweise vorlegen kann, stellt er ihr ein Schreiben aus, in dem bestätigt wird, die folgenden Personen seien beim UNHCR als Flüchtlinge registriert. To whom it may concern - für den, den es angehen könnte. Aber wen geht hier schon irgend etwas an.
Das Sammeltaxi fährt in die falsche Richtung, so stehen wir plötzlich mitten an der Landstraße, noch gute fünf Kilometer von Vaters Auto entfernt. Als der Polizist, mit dem wir sprechen, hört, daß wir aus Deutschland kommen, fängt er zu schwärmen an: Das beste Land der Welt sei dies, die besten Leute. Als Maschinenbauingenieur wisse er, wovon er spricht. Und dann stoppt er ein Auto und "requiriert" es für uns. Der Fahrer nimmt's gelassen heiter, wir entschuldigen uns - kein Problem.
An diesem Abend ist die Stimmung im Zelt Nr. 46 der Familie Aremi noch gedämpfter, als an den Abenden zuvor. Morgen Mittag geht unsere Fähre. Naser muß in sein Büro, Christianes Mutter hat nicht ewig Urlaub, und die beiden Kinder haben sicher Sehnsucht nach ihren Eltern. Wie wird es hier weiter gehen? Die mitgebrachten Plastikkärtchen werden herumgereicht, die Frauen prüfen kritisch, wie sie auf den Fotos aussehen. Wozu die Dinger gut sein sollen? Achselzucken. Zu Hause hat man so etwas jedenfalls nicht gebraucht, man kannte sich doch. Naser bespricht, was er wird schicken sollen, wie man wird Kontakt halten können. Unvorstellbar, wie die beiden Schwangeren, Nassers Schwester und seine Schwägerin, hier ihre Kinder gebären sollen?
Alles, was wir an Geld entbehren können, lassen wir zurück. Angesichts der neuen Hunderter, die ich zücke, äußert Nassers Mutter ihre Sorge um mein Geld. "Mein Geld" denke ich, womit hätte ich es denn mehr verdient als sie? Das sei nicht meines, sondern gehöre dem, der es ausgestellt und unterschrieben hat, dem Bundesbankpräsidenten Tietmeyer, der derzeit aber keine bessere Verwendung habe, sich bei passender Gelegenheit sicher darüber freue, wenn man es ihm zurückbrächte. Naser muß lachen bei der Übersetzung und auch Christiane, die anderen verstehen den Scherz nicht, wenigstens aber, daß es offensichtlich einer war. Die Autos müssen umgeparkt werden, Anwohner verlangen jetzt hartnäckig "Parkplatzgebühren" von den Flüchtlingen, umgerechnet 2 Mark pro Tag. Es gibt keinen Wald ohne Schweine. An den morgigen Abschied wage ich nicht zu denken, allein die Erschöpfung gewährt mir ein paar Stunden Schlaf.
Die Trennungsszenen vermag ich nicht zu schildern. Auf dem Heimweg werten wir die neuesten Nachrichten aus, sobald wir ihrer habhaft werden. Nichts deutet darauf hin, daß Nassers Familie in absehbarer Zeit zurückkehren kann. Wir versuchen weiterzudenken. Irgendwann muß dieser Krieg ja zu Ende gehen, und dann wird man aufbauen helfen müssen. Allen auf dem Balkan, einschließlich der Serben, auch wenn es Naser Mühe kostet, dies zu verstehen und zu akzeptieren. Wir brauchen eine Bodentruppe, eine große Zahl von gut dafür ausgebildeten Aufbauhelfern, mit deren "Rekrutierung" man bereits jetzt beginnen muß.
* alle Namen geändert [Zurück]Dieser Artikel erschien im Oranienburger Generalanzeiger vom 08./09. Mai 1999